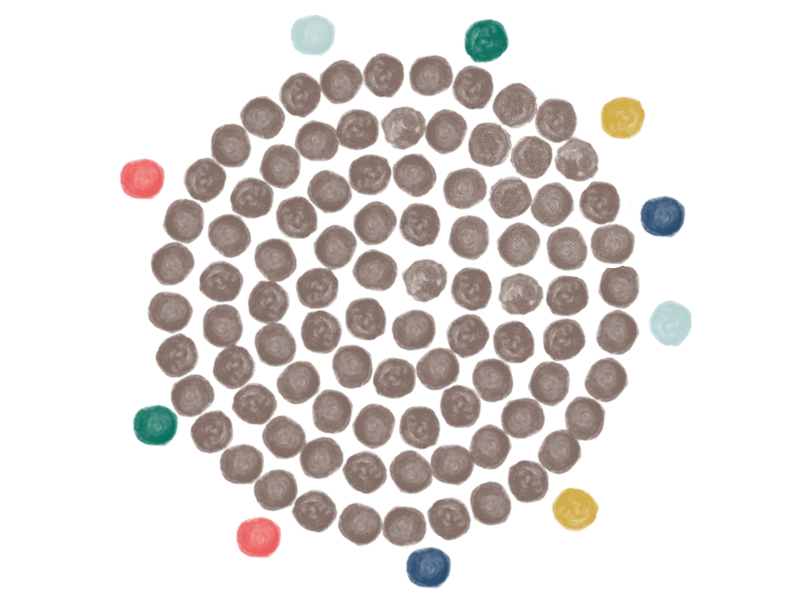Der Bruder unser Autorin hat eine Behinderung. Ein Plädoyer für echte Inklusion.
„Mhmmmm“, sagt Matthias. „…mhmmm“ Er hält seinen Kopf schief und hat sich tief über die Uno-Karten gebeugt. Eine nach der anderen hebt er ein Stück hoch und begutachtet sie noch in der Hand. Dann grinst er mich an. Es ist dieses Lächeln, sein „ich mache jetzt was Böses und was Lustiges“- Lächeln.
„Zweimal drei ist sechs“, sagt er dann, wirft einen grünen Zweier und einen gelben Dreier auf den gelben Sechser und grinst mich an.
„Matthias“, sage ich und wir müssen beide lachen.
Ich hatte einen blöden Tag. Ich war gestresst und schlecht gelaunt und musste bei meinen Eltern vorbei. Ich wollte am liebsten gleich weiter, keine Ahnung wohin, einfach weiter. Dann saß Matthias in der Küche und trank Apfel-Karottensaft und jetzt spielen wir die vierte Partie UNO.
Matthias ist mein Bruder, zwei Jahre jünger. In meinen Erinnerungen gibt es keine Welt ohne ihn. Er war schon immer auf den Fotos neben mir, wie ich Geburtstagskerzen ausblase und eine Schultüte halte. Als Kinder sind wir Hand-in-Hand eingeschlafen, aus Angst vor Monstern, aus Freude Hand-in-Hand zu sein. Alles an ihm ist selbstverständlich für mich, wie es nur Menschen sind, mit denen man mehr Erinnerungen teilt, als man zählen kann.
Ich glaube nicht, dass es besondere Menschen gibt. Aber es gibt Menschen, die besser oder schlechter zueinander passen. Und Matthias passt sehr gut zu mir.
Matthias hat Trisonomie 21, früher nannte man das Down-Syndrom. Er wurde mit einem Chromosom mehr geboren als die meisten Menschen und hat damit eine sogenannte Intellektuelle Behinderung. Für die meisten Menschen bedeutet das, dass er irgendwie arm ist. Für mich heißt das: Es gibt mehr als eine Version von richtig. Mit jemandem mit Behinderung aufzuwachsen bedeutet, dass „normal“ nicht das einzige Normale ist. Es bedeutet aber noch mehr als das.
Ich habe so ein Glück, denke ich an dem stressigen November Nachmittag. Matthias mischt die UNO-Karten langsam und hingebungsvoll. „Das ist Zeitverzögerung, los, los“, sage ich. „Claraaaaa“, sagt Matthias, er zieht das a genervt in die Länge, ich schaue ihn mahnend an, wir kichern, er gibt mir endlich die siebte Karte. Ich sortiere meine Karten nach Farben, Matthias seine gar nicht. „Du los“, sagt er. Er kann nicht legen, das weiß ich. Ich gebe nach und werfe die erste Karte.
Ich glaube nicht, dass es besondere Menschen gibt. Aber es gibt Menschen, die besser oder schlechter zueinander passen. Und Matthias passt sehr gut zu mir. Er scheint zu ahnen, wann ich umarmt werden muss, wann man fragen muss, wie es mir geht, wann es besser ist, mich in Ruhe zu lassen. Er gibt mir das Gefühl richtig zu sein. An Tagen wie diesen merke ich, wie sehr er zuhause ist. Ein Ort, ein Mensch, zu dem ich immer kommen kann, der mich hält.
Ich wollte erst einen Text schreiben, in dem es um meinen Bruder, aber nicht um seine Behinderung geht. Er ist mehr als das, weiß ich, und das wollte ich zeigen. Jetzt möchte ich doch, dass es auch darum geht. Ich ringe mit den Worten, wenn es um Matthias und seine Behinderung geht. Ich sage er ist nicht normal, aber er ist es doch. Ich sage er ist fabelhaft und er ist einfach wer er ist, der Rest ist unwichtig. Ich sage, dass es keinen Unterschied macht, ob man eine Behinderung hat oder nicht.
Über diese anderen Erfahrungen müssen wir sprechen, weil sie auch aufgrund von Einschränkungen passieren. Daran ist nicht seine Behinderung schuld, sondern unsere Gesellschaft.
Das stimmt. Aber es stimmt auch, dass Matthias andere Erfahrungen macht und andere Dinge will, als die meisten 21-Jährigen. Dass er immer schon andere Erfahrungen gemacht hat als die meisten Menschen in unserem Umfeld.
Matthias führt ein schönes, ein volles Leben. Aber er hat andere Möglichkeiten und Herausforderungen. Matthias hat keine Matura, er macht nicht alleine Auslandsreisen, er wohnt in keiner WG und feiert nicht bis in die Morgenstunden.
Er kocht für jeden aus der Familie nach dem Mittagessen Kaffee, einen kleinen für meinen Vater, verlängert für meine Mutter, extra stark für meine Schwester. Er mag Sport und das Hochbeet gießen. In der Arbeit will er später vor allem helfen. Er kann stundenlang spielen, entführt sich in eigene Welten, leise spricht er zu sich, von Rittern und Polizisten, von großen Kämpfen.
Über diese anderen Erfahrungen müssen wir sprechen, weil sie auch aufgrund von Einschränkungen passieren. Daran ist nicht seine Behinderung schuld, sondern unsere Gesellschaft.
Matthias könnte Matura und Interrail machen, er könnte aufwachsen wie ich aufgewachsen bin. Er bräuchte dazu nur andere Dinge, die er nicht bekommt. Zumindest nicht bedingungslos und ausreichend. Staatliche Maßnahmen reichen nicht. Sie bieten Menschen mit Behinderungen Mitleid statt Solidarität, Schutz statt Selbstbewusstsein, Abhängigkeit statt Begleitung: Menschen mit Behinderungen besuchen immer noch zu großen Teilen Sonderschulen, sie werden in Werkstätten beschäftigt, in denen sie kein Geld verdienen. Nur selten haben sie die Möglichkeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Das Problem sind wir, die Menschen ohne Behinderungen. Unsere Idee von “normal” verunmöglicht vielen Menschen mit Behinderung eine Normalität.
Sie gehen meist von Anfang an einen Sonderweg, abseits unserer Gesellschaft, mit ihren Herausforderungen und Ungerechtigkeiten, aber auch mit ihren Freiheiten und Errungenschaften. Viel hängt von Familien wie meiner ab, die sich engagieren müssen, um ihren Angehörigen zu ermöglichen, was selbstverständlich sein sollte: ein Leben mit den Rechten, die auch ich habe. Das muss sich ändern. Menschen wie Matthias haben das Recht freie Entscheidungen zu treffen, wie alle anderen Menschen auch. Sie verdienen Begegnungen auf Augenhöhe. Alles andere ist scheinheiliger Scheiß.
Denn diese Nachteile haben Menschen mit Behinderungen nicht, weil sie “schwach” sind oder eine Behinderung traurig und ungesund macht. Das Problem sind die Einschränkungen unserer Gesellschaft. Strukturen, die Menschen aufgrund einer Behinderung ausschließen. Das Problem sind wir, die Menschen ohne Behinderungen. Unsere Idee von “normal” verunmöglicht vielen Menschen mit Behinderung eine Normalität.
Inklusion zu Ende zu denken bedeutet, unseren Arbeitsmarkt, unsere Schule, eigentlich alles neu zu denken und einzusehen: Wir Menschen sind richtig wie wir sind. Nur eben auf unterschiedliche Art und Weise.
Das macht mich nicht nur wütend, weil ich einen Bruder mit Behinderung habe, sondern weil es um soziale Gerechtigkeit geht. Obwohl etwa zwanzig Prozent der Menschen eine Behinderung haben, sehen wir sie kaum in den Medien, auf der Straße, in der Schule. Menschen mit Behinderungen, ihre Rechte und Interessen, werden von unserem System unsichtbar gemacht. Wer nicht will, wer es nicht aktiv versucht, setzt sich nicht oder kaum mit Menschen mit Behinderungen auseinander, setzt sich selten für sie ein. Niemand ist gegen Inklusion. niemand hat etwas gegen Menschen mit Behinderung. Alle loben das Engagement für diese Gruppe. Aber niemand interessiert sich dafür. Auch das muss sich ändern. Auch Menschen ohne Behinderungen müssen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen.
Inklusion ist ein revolutionäres Konzept, das wird oft vergessen. Sie bedeutet, dass das System ein Problem ist, weil es nicht zu den Menschen passt und nicht ein Mensch, weil er nicht ins System passt. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für jene, die marginalisiert sind. Inklusion zu Ende zu denken bedeutet, unseren Arbeitsmarkt, unsere Schule, eigentlich alles neu zu denken und einzusehen: Wir Menschen sind richtig wie wir sind. Nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt mehr als eine Version von normal. Es gibt mehr als eine Version von richtig.
Matthias zeigt, was man verpasst, wenn man sich für eine eindeutige Welt entscheidet. Inklusion ist nicht nur ethisch wichtig, sie ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es geht um Solidarität und das alleine sind Argumente genug. Menschen mit Behinderungen gehören in die Mitte unsere Gesellschaft, weil das ihr Recht ist. Aber, dessen bin ich mir sicher, sie bereichern unsere Gesellschaft. So wie Matthias.
„Versperrt“ ruft er während unseres zweiten UNO-Spiels und legt die Karte mit dem durchgestrichenen Kreis. Er darf nochmal legen. „Ich 2 Karten“, sagt er und grinst. Er hat noch eine Sperr-Karte, ruft UNO und legt dann auch seine letzte und schaut mich triumphierend an.
Wenn er mir erzählt, was sein bester Freund macht, verstehe ich, dass die großen Fragen, die ich mir stelle, nicht größer sind als seine.
Wenn ich mit Matthias UNO spiele erinnere ich mich, wo ich herkomme und wo ich hin will. Ich glaube oft, dass ich mich auf das, worauf es ankommt fokussieren muss, auf die wichtigen Dinge. Wir haben aber auch ein Recht auf die kleinen Dinge.
Wenn Matthias unseren Küchentisch deckt, dann ist das alles, das gerade zählt und jedes Mal, wenn ich ihn beobachte, merke ich, dass er recht hat. Wenn er mir erzählt, was sein bester Freund macht, verstehe ich, dass die großen Fragen, die ich mir stelle, nicht größer sind als seine. Wenn er ein Bild malt, meine Großeltern im Ruderboot, wenn er langsam Buntstift für Buntstift hebt, vor jedem Strich überlegt, als wäre er der wichtigste, verstehe ich wieder und wieder, dass nichts wichtiger ist als dieses Bild. Nichts ist wichtiger als wer und wie wir gerade sind.
Text: Clara Porak
Grafik: Moritz Wildberger, Grundlage: Aktion Mensch, Grafik zu Exklusion, Integration, Inklusion