Was ist Mut? Fünf Menschen erzählen – von ihrem großen und kleinen, klassischen und neuen Mut.

“Die Feuerwehr ist eine ziemliche Männerdomäne”
Jessica engagiert sich seit sie ein Kind ist bei der freiwilligen Feuerwehr. Die Behauptung in der Gruppe erfordert für sie mehr Mut, als viele Einsätze.
„Ha, cool, dann kannst du sicher ordentlich trinken, sagen die meisten, wenn sie hören, dass ich bei der freiwilligen Feuerwehr bin. Das ist ein nicht ganz unbegründetes Vorurteil. Ich bin bei der Feuerwehr seit ich ein Kind bin. Meine Familie und ich haben damals in einem Dorf gewohnt und alle Freunde meiner Eltern im Nachbardorf waren bei der Feuerwehr. Wir sind dann auch hingezogen und sie haben gesagt: Okay, dann muss einer von uns zur Feuerwehr. Und das war dann neun, zehn Jahre, dann bin ich weggezogen. Seit einem halben Jahr bin ich wieder in meinem Heimatort – back to the roots – und bei einer neuen Feuerwehr.
Am meisten Spaß macht mir der Kontakt mit den Menschen, der Gedanke, ihnen helfen zu können, auch wenn es gottseidank nicht oft Einsätze gibt. Und die Gemeinschaft, in die man sich einbringen kann. Ich würde sagen, man braucht schon Mut, um bei der Feuerwehr zu sein. Man muss mit allem rechnen. Es kann sein, dass sich ein Brand ausweitet, dass man eine Rauchvergiftung bekommt, dass man sich verletzt. Und man muss sich bewusst sein, was für eine Verantwortung man hat. Man muss wissen, wie man alle Geräte bedient und wie man mit einer verletzten Person umgeht.
Den meisten Mut habe ich nicht während der Einsätze gebraucht, sondern, wenn ich mich wo einbringen sollte. Wenn ich gesagt habe: Nein, das sehe ich anders. Angst und Mut hängen für mich direkt zusammen. Ich habe früher viel Angst gehabt meine Meinung zu äußern, aber jetzt sage ich mir: Du darfst sprechen, du darfst sagen, wenn dir etwas nicht passt, du darfst sagen, wenn du etwas willst. Die Feuerwehr ist eine ziemlich Männerdomäne: Wir sind etwa dreißig Männer und drei, vier Frauen. Ich bin die einzige wirklich aktive Frau. Als Frau, als Mädchen, muss man sich schon beweisen.
Einmal ist ein Baum mitten in der Nacht auf die Straße gefallen, da war ich mit. Die Männer haben den Baum zusammengeschnitten und weggetragen und da lag dann noch das ganze Geäst und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt endlich was machen kann. Aber dann kam ein Kollege, nahm mir den Besen aus der Hand und meinte: Komm, ich nehme dir das ab. Das habe ich schade gefunden. Bei den Einsätzen habe ich eigentlich keine Angst, auch wenn es manchmal gefährlich ist. Die Kollegen hatten immer die Oberhand und haben das geregelt, ich vertraue ihnen und dann habe ich keine Angst. Aber vielleicht ist es schon Gewohnheit, dass es für mich irgendwie normal ist zum Beispiel bei einem Autounfall dabei zu sein. Das Persönliche erfordert mehr Mut für mich.“
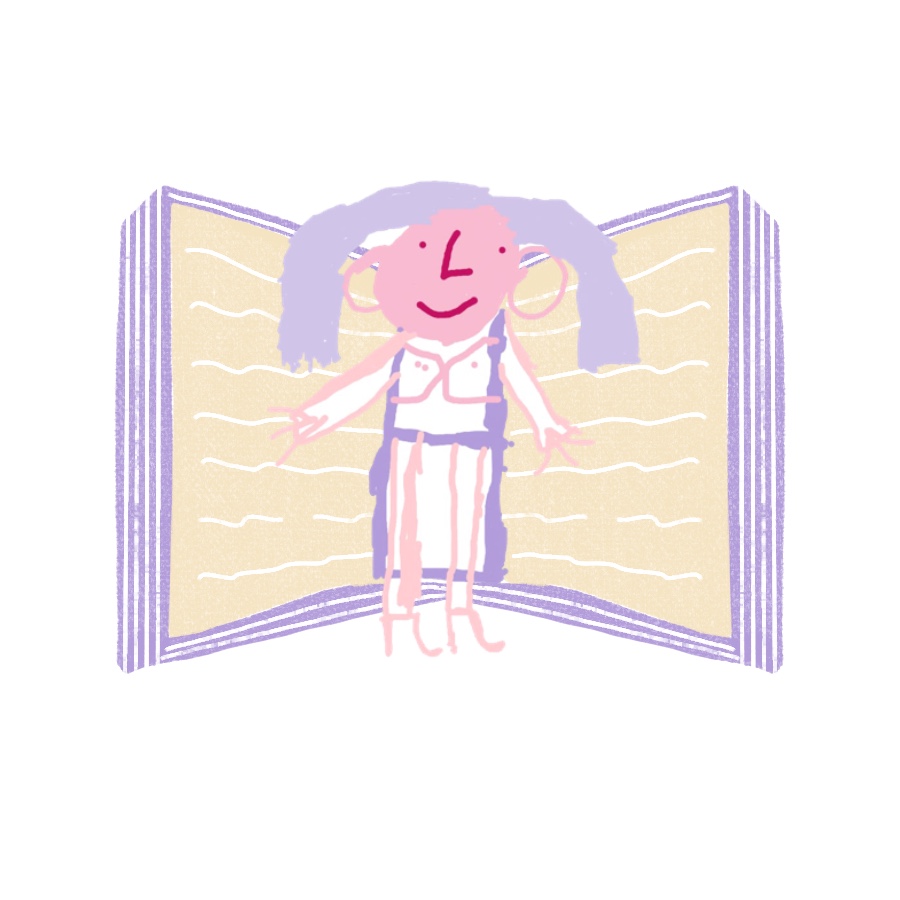
“Wenn die Gerti es kann, kann ich es auch.”
Gerti Zupanich hat sich erst mit 58 ihren größten Wunsch erfüllt: Zu Studieren. Über den Blick junger Studierender und lebenslanges Lernen.
“Eigentlich hat mich der Wunsch zu studieren mein ganzes Leben lang begleitet. Leider war es früher nicht so üblich, dass Frauen studieren dürfen. Aus diesem Grund konnte ich mir diesen Traum erst spät, mit 58, erfüllen. Als ich das erste Mal auf die Universität gegangen bin, war das schon ein komisches Gefühl. Wie wird man von den jüngeren Studierenden aufgenommen? Und wie von den Lehrenden? Wird man etwas Besonderes sein, oder werden sie eh nicht schauen? Heute kann ich sagen: Dass ich begonnen habe zu studieren, war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Es hat mir eine ganz andere Welt eröffnet und dafür gesorgt, dass ich mir im Anschluss noch andere Sachen zugetraut habe.
Obwohl ich es mir sehr gewünscht habe, hatte ich Angst vorm Studieren. Aber wenn man den Mut nicht hat, etwas zu tun, was einem schon lange vorschwebt, dann denkt man sich, wenn man älter ist: Warum hab‘ ich das nicht probiert? Wenn man scheitert, passiert ja erstmal nicht sehr viel. Sich das erste Mal in eine Vorlesung zu begeben, braucht trotzdem ein bissl Mut! Man ist ja nicht so wie die Jungen. Obwohl, denen geht es vermutlich genauso, wenn sie anfangen. Mit jeder Vorlesung wurde es besser. Ich wurde selbstbewusster und irgendwann war diese Angst total verschwunden. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, vielleicht sogar weniger. Auch die jungen Studierenden waren im Umgang mit mir sehr kooperativ und offen. Das hat wesentlich dazu beigetragen, die Angst zu minimieren.
Doch meine Entscheidung kam nicht bei allen gut an. Meine Töchter hatten zuerst wenig Verständnis und haben befürchtet, ich wäre aufgrund meines Alters überfordert. Damals war ich 60. Jetzt bin ich 80 und sie jammern immer noch, wenn ich wieder irgendwas Neues mache. Aber inzwischen haben sie sich schon daran gewöhnt. Die Möglichkeit, so spät zu studieren, bedeutet für mich lebenslanges Lernen: das ist mein Hauptthema, etwas, das ich jedem empfehle. Bis zur letzten Minute kann man dazulernen! Im Internet erfährt man jeden Tag etwas Neues – auch wenn es nicht immer positiv ist. Aber auch das Negative muss man zur Kenntnis nehmen.
Mein Ziel war es letztendlich wohl auch, mehr auf lebenslanges Lernen aufmerksam zu machen. Deshalb habe ich drei EU-Projekte zur Erwachsenenbildung geleitet. Das war schon mutig. Aber ich bin auch sehr ehrgeizig. Einfach nichts zu machen, wäre nichts für mich. Ich bin also in Schreibwerkstätten gegangen und habe Leute gesucht, die bei mir mitmachen. Ich konnte den anderen Mut zusprechen und meine Erfahrung weitergeben. Viele haben zu mir gesagt: Wenn die Gerti das macht, dann mach ich mit. Auch, wenn sie zu Beginn oft nicht wussten was auf sie zukommt. Es ist schön und erstaunlich zu sehen, wie sich Leute entwickeln können, wenn sie sich trauen. Und am Ende haben wir sogar Preise damit gewonnen. Das war natürlich nicht der Grund, wieso wir es gemacht haben. Aber für mich vielleicht schon ein Ziel.”

“Wir haben Angst, ohne Leistung nicht geliebt zu werden”
Christoph Schattleitner ist TV-Journalist und lebt in Köln. Er spricht über seine Depression und Therapie – und wie das alles mit toxischer Männlichkeit zusammenhängt.
„Viele trauen sich nicht, eine Therapie zu beginnen. Oft fehlt es an Wissen, was eine Psychotherapie eigentlich ist. Ein Therapeut hilft dir, deine Gefühle zu erkennen und dein Verhalten besser zu verstehen – wenn du das willst. Das ist das Wichtige: Du entscheidest, ob und wie du Unterstützung bei deiner Entwicklung haben willst. Das ist wie beim Haare-Schneiden: Das kann man auch selber machen, muss man aber nicht. Wenn man das so sieht, schwindet vielleicht die falsche Ehrfurcht vor der Psychotherapie, die viele erst anfangen, wenn nichts anderes mehr geht.
Auch ich habe eine Therapie lange ausgeschlossen, bis ich im Sommer 2018 erkannt hab: So kann es nicht weitergehen. Mir hat geholfen, was Psychotherapeut:innen so freundlich “Leidensdruck” nennen. Diesen Knall an die Wand, wo man sagt: Okay, jetzt geht’s nicht mehr. Ich leide mehr unter der aktuellen Situation als unter der Scham zum Therapeuten zu gehen. Bei mir war das ein Moment in der U-Bahn, als ich keine Energie mehr hatte und mir auch nichts einfiel, wer oder was mich glücklich machen könnte. Ich glaube, das ist der häufigste Weg. Man spart sich natürlich viel Leid, wenn man die Therapie früher beginnt.
Das erfordert aber noch mehr Mut, weil es keinen nach außen sichtbaren Fuckup gibt, keine „Rechtfertigung“ für die Therapie. Zu sagen, ich will eine Therapie, heißt oft zu sagen: Ich schaffe es alleine nicht. Was beim Friseur kein Problem ist, ist bei der Therapeut:in vor allem für Männer sehr schwierig. Die Symptome von psychischen Krankheiten widersprechen unserem Bild von traditioneller Männlichkeit. Wer depressiv, also kaum handlungsfähig ist, ist nicht „Herr der Lage“. Und wer sich behandeln lässt, ist abhängig. Wir lernen aber, dass ein Mann jemand ist, der dank eigener Kraft niemanden braucht. Erst dann hat er Anerkennung verdient.
Dieser Glaube sorgt für viel globales Unheil und belastet individuell. Die Mehrheit der Männer lebt in der ständigen Angst, ohne Leistung nicht geliebt zu werden. Das ist durch Erziehung und gesellschaftliche Rollen sehr präsent: Dass man ohne Arbeit nicht anerkannt, wertgeschätzt, geliebt wird. Mut hilft, aus diesem Karussell heraus zu hüpfen und zu sagen: Ich mach nicht mehr mit bei diesem Spiel, diesem Wettrennen nach einer einzelnen Definition von „Wertvoll“-Sein. Ich spiele mein eigenes Spiel.
Sich Dinge einzugestehen, die man ganz tief versteckt hat, ist für mich eines der schönsten Gefühle. Wer an sich selbst arbeitet, begegnet Wahrheiten, die befreien: Das, was ich damals gesagt habe, ist eine Ausrede. Eigentlich schlummert tief in mir: Ich hab keine Lust auf diesen Job, diese Beziehungen, dieses Studium, dieses wasauchimmer. Im Laufe der Therapie lernt man, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und für sie einzustehen, selbst wenn es negative Konsequenzen bedeutet. Das ist Selbstwert.“

“Auf einem Schiff kann man nicht einfach gehen”
Sarah Siemers hat auf einem Segelschiff den Atlantik überquert. Mit andererseits hat sie darüber gesprochen, warum das Segeln, die Unwetter und die Gefahren auf See, nicht das Mutigste an ihrer Reise waren.
Ich habe überlegt, wie ich zur Klimakonferenz in Chile komme. Fliegen wollte ich nicht. Ich wollte einen nachhaltigen Weg wählen. So kam es, dass ich auf einem Schiff nach Südamerika gesegelt bin. Mit einem Team aus verschiedenen Ländern in ganz Europa. Segeln war ich davor noch nie. Das war eine Herausforderung, ich war aufgeregt. Am 2. Oktober 2019 haben wir in den Niederlanden abgelegt. Über Marokko, Teneriffa und die Kapverdischen Inseln sind wir nach Brasilien gefahren. Kurz vor Weihnachten sind wir in Cartagena angekommen. Insgesamt waren wir 80 Tage unterwegs. Am Anfang gab es die meisten Probleme. Denn die Nordsee ist sehr unruhig, es gibt hohe Wellen. Für mich war das anstrengend, ich habe es ja auch zum ersten mal gemacht. Das Segeln haben wir schrittweise gelernt. Die Schiffsbesatzung hat es uns beigebracht.
Ob man für das Segeln wirklich Mut braucht, das weiß ich nicht. Aber wer Angst vor Enge oder Wasser hat, für den ist das nichts. Ich fand das Segeln nicht so mutig, für mich war es befreiend. Ich war so nah an der Natur, es war schön. Für mich war es am mutigsten mit 36 anderen Menschen so lange auf dem Schiff zu sein. Menschen, die ich nicht kannte. Ich wusste, dass ich nicht weg kann von dem Schiff, wenn ich mich vielleicht nicht so zugehörig fühle. Das hat mir davor Angst gemacht. Denn auf einem Schiff kann man nicht einfach gehen. Man muss Konflikte austragen und miteinander reden, das finde ich mutig. Man kommt sich sehr nahe, weil man so viel Zeit in so vielen anstrengenden Situationen miteinander verbringt.
Auf dem Segelschiff gab ein paar gefährliche Situationen. Einmal ist uns eine Schweißmaschine heruntergefallen, nur einen Meter von einer Person weg. Einmal hat sich ein Mast von einem Segel gelöst und ich konnte mich gerade noch ducken, sonst wäre mir der Holzstamm an den Kopf geknallt. Aber es ist gottseidank immer gut gegangen. Tagsüber, wenn kein Wind war, konnten wir vom Schiff ins Meer springen. Ich hatte Angst, dass ich abtreibe, weit weg von unserem Schiff. Das war das einzige Mal, dass ich Panik bekommen habe. Ich dachte, ich treibe zu weit weg oder gehe unter. Es kann natürlich auch immer vorkommen, dass jemand über Bord geht. Aber wir haben schon sehr gut aufgepasst. Ich war für die Nachtwache verantwortlich. Von 1 bis 5 Uhr morgens. Jede Stunde musste ich ein Logbuch darüber führen, was gemacht wurde.
Wie man mutig wird, das weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, dass meine Leidenschaft und mein Wille mich dazu bringen, mutige Dinge zu tun. Mutig finde ich, wenn man seinen Weg geht, auch wenn das für andere nicht als normal gilt. Dass man macht, was man für richtig hält. Und dass man zu sich selber steht. Das finde ich mutig. Es gab nichts in meinem Leben, das mir so viel Spaß gemacht hat wie das Segeln. Und nichts, das mir so viel Energie gegeben hat. Wegen Corona konnte ich jetzt nicht mehr segeln, aber ich würde es in Zukunft gerne öfter machen.

“Ich bin beweglicher denn je”
Maria Selzer wollte immer Tänzerin werden. Sie erklärt, wie Angst und Mut für sie zusammenhängen.
„Ich bin im Waldviertel aufgewachsen und war ein sehr unehrgeiziges und eher burschikoses Kind. Tanzen und Musizieren war nicht cool in meinem Freundeskreis. Nach der Matura hätte ich gerne was mit Tanz gemacht, aber meine Mutter hat es mir ausgeredet. Sie meinte, ich lande dann mal in einem “Tingeltangel”. Also habe ich Sport studiert – das einzige, was ich in der Schule wirklich gut konnte – und bin Lehrerin geworden. Ich habe bald entdeckt, dass mir vieles am Lehrerberuf nicht so gut gefällt: Dieses ganze beurteilen, das Kopfige, intellektuelle war gar nicht meins. Das war vor allem für mein zweites Fach, Französisch, wichtig. Aber ich habe es durchgezogen.
Das Tanzen hat mich nicht ganz losgelassen. Also habe ich immer wieder Fortbildungen gemacht – Bauchtanz, Hip Hop, aber hauptsächlich zeitgenössischer Tanz – und auch Choreographien mit meinen Schüler:innen begonnen. Jedes Mal, wenn es mir psychisch schlecht gegangen ist, habe ich einen Tanzworkshop gemacht. Irgendwann bin ich draufgekommen: Okay, das bin eigentlich ich. Mein Traum war immer auf der Bühne zu tanzen. Dann hab ich selbst weitere Kinder bekommen und das Tanzen wieder aus den Augen verloren. Und irgendwann hatte ich sehr große Bewegungseinschränkungen, konnte nur noch mit Krücken gehen. Für zehn Jahre war es das dann mit dem Tanzen.
Ich bin ein ängstlicher Mensch. Es gibt Tausende Sachen, die mir Angst machen. Doch als ich 2005 das erste Mal auf einer Bühne gesungen habe, habe ich entdeckt, dass ich davor überhaupt keine Angst habe. Das ist ganz eigenartig. Ich glaube es hat mit der Erwartungshaltung zu tun: Als ich nach zwei Hüft-Operation wieder langsam mit Sport begonnen habe, habe ich gemerkt, dass ich mich ganz anders bewegen kann. Als mir bewusst wurde, dass ich vielleicht auch wieder tanzen kann, war das ein unglaublicher Moment. Ich habe bemerkt, dass ich beim Tanzen in der Amateurklasse überall eine der Besten war. Zuerst konnte ich das gar nicht glauben. Mittlerweile bin ich seit zwei Jahren in Pension und gebe Tanzkurse an ältere Damen. Ich bin beweglicher denn je und habe große Lust zu tanzen. Und weil niemand etwas von mir erwartet – ich auch nicht – ist es total super, diese Resonanz zu empfinden.
Ich glaube nicht, dass Mut etwas damit zu tun hat. Aber sehr wohl, dass man etwas tut, obwohl man Angst hat. Ich habe heute auch noch Angst. Ich gehe nicht Skifahren, weil ich Angst habe, dass dadurch diese wunderbare Sache – nämlich schmerzfrei leben zu können – wieder verloren geht. Das Tanzen ist mir so wertvoll. Und ich glaube auch, dass ich durch mein Alter profitieren kann: Ich muss niemanden was beweisen. Aber ich kann Freude weitergeben mit dem Tanzen. Älteren Leute, die sehr selbstkritisch sind, fällt es manchmal schwer, Schrittfolgen nachzuvollziehen. Deswegen arbeite ich viel mit angeleiteter Improvisation. Ich sage den Leuten zum Beispiel: Stell dir vor, du bist in einer großen Blase. Jetzt mach die Augen zu und versuche diese Blase mit Händen, Ellbogen, Knien, Füßen überall zu berühren.
Ich glaube die Gesellschaft begreift langsam, dass ältere Menschen durchaus etwas zu bieten haben und dass auch die Jungen davon profitieren können. Ich fühle mich nicht alt. Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, auch mit 80 oder 90 noch als Barsängerin zu arbeiten.“
Protokolle: Franziska Bock, Katharina Brunner, Fabian Füreder, Sebastian Gruber, Lisa Kreutzer, Katharina Kropshofer, Clara Porak, Nikolai Prodöhl
Grafik: Armin Längle, Clara Sinnitsch


